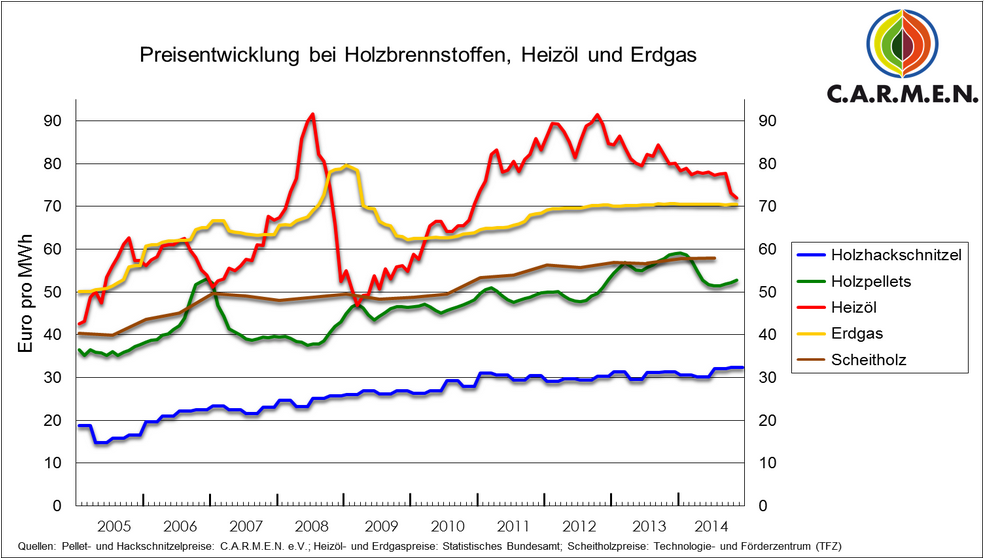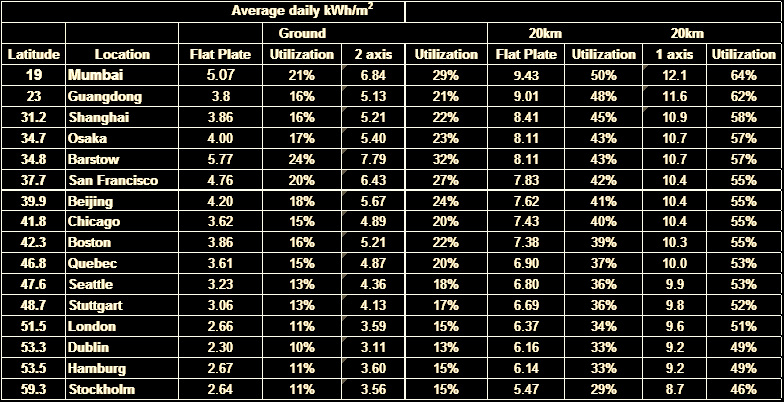Der Bedarf an Pumpspeicher
Im Jahr 2017 war ich auf zwei Pumpspeicher Tagungen, "Pumpspeicherwerke" in Essen am 10. Juli 2017 und am 29./30. November auf der 3. Internationalen Pumpspeicherkonferenz in Salzburg, die Ergebnisse sind etwas widersprüchlich und ich will sie in diesem Blogbeitrag diskutieren
 |
| Internationale Verteilung von Pumpspeicherwerken. |
Pumpspeicher in Deutschland
Die deutschen Pumpspeicher haben eine Kapazität von 40 Gigawattstunden und eine Anschlussleistung von 6 GB, dies sind gewaltige Zahlen allerdings im Verhältnis zum Stromsystem eher klein, die Leistung ist etwa ein Zehntel des deutschen Stromverbrauchs und die Kapazität könnte noch nicht einmal eine Stunde lang Deutschland mit Strom versorgen (Falls die Leistung reichen würde).
Die Aufgabe der Pumpspeicher lag aber in ihrer ursprünglichen Funktion nicht darin, Deutschland etwa über Nacht mit Strom zu versorgen, wenn die Sonne nicht scheint, sondern Ausfälle von Kernkraftwerken zu managen oder Spitzenlasten in der Mittagszeit, die insbesondere durch das Einschalten vieler Elektroherde früher entstanden sind, abzudecken.
Heute hat sich das Bild massiv gewandelt. Tagsüber trägt die hohe Zahl an Fotovoltaik-Anlagen, mit etwa 40 GB installierter Leistung, erheblich zum Abbau von Strombedarfsspitzen bei. Wenn auch nicht immer insbesondere natürlich im Winter, wenn es sehr bewölkt ist und nur wenige hundert Megawatt von der Fotovoltaik erzeugt werden. Dies führt dazu, dass der Strompreis nicht mehr so stark schwankt wie früher und genau deshalb haben die Pumpspeicher Betreiber ein erhebliches Problem ihre Anlagen zu finanzieren.
Es ist inzwischen soweit, dass selbst fertige Anlagen kaum mehr den Erlös bringen um den Betrieb aufrecht zu erhalten. So gaben einige Sprecher auf der Tagung in Essen an, dass im Fall einer größeren Revision, etwa den Austausch einer Turbine, das Kraftwerke eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt werden müsste.
Dies hätte natürlich erhebliche Folgen für das Stromnetz, denn die Pumpspeicher dienen eben auch zur Stabilisierung des Netzes und sollen zukünftig ja Solarstrom und Windstrom puffern um zu anderen Zeiten des Bedarfs die entsprechende Energie zur Verfügung zu stellen.
An einen Neubau ist daher in Deutschland praktisch überhaupt nicht zu denken, was auch dazu führte, dass das bekannte Projekt Atdorf im Südschwarzwald, gestoppt wurde, obwohl bereits 60 Millionen Euro für die Planung ausgegeben wurden.
Auf der Internationalen Pumpspeicher Tagung in Salzburg wurden die berühmte Anlage der Illwerke von Professor Helmut Jaberg vorgestellt. Ein Pumpspeicher mit über 800 m Fallhöhe und über einen Gigawatt Leistung.
Durch die große Speicherkapazität können auch Überschüsse, wie sie aus längeren Starkwind-Perioden kommen aufgenommen werden, wenn die Leitungen ausreichen. Bei Flaute kann die Energie dann abgerufen werden und teurer verkauft werden.
Dies wird in den Medien oft irreführend dargestellt, als ob wir Strom ans Ausland verschenken und teuer wieder importieren. Nein, da liegt eine Dienstleistung dazwischen, dass die Energie gespeichert wird und genau dann geliefert wird, wenn wir bedarf haben!
Im Vortrag der Beratungsfirma BET aus Aachen wurden weitere Einnahmequellen vorgestellt.
Die Aufgabe der Pumpspeicher lag aber in ihrer ursprünglichen Funktion nicht darin, Deutschland etwa über Nacht mit Strom zu versorgen, wenn die Sonne nicht scheint, sondern Ausfälle von Kernkraftwerken zu managen oder Spitzenlasten in der Mittagszeit, die insbesondere durch das Einschalten vieler Elektroherde früher entstanden sind, abzudecken.
 |
| Rene Kühne zur Entwicklung des Spotpreis, die Spitze am Mittag ist verschwunden. (Folien) |
Heute hat sich das Bild massiv gewandelt. Tagsüber trägt die hohe Zahl an Fotovoltaik-Anlagen, mit etwa 40 GB installierter Leistung, erheblich zum Abbau von Strombedarfsspitzen bei. Wenn auch nicht immer insbesondere natürlich im Winter, wenn es sehr bewölkt ist und nur wenige hundert Megawatt von der Fotovoltaik erzeugt werden. Dies führt dazu, dass der Strompreis nicht mehr so stark schwankt wie früher und genau deshalb haben die Pumpspeicher Betreiber ein erhebliches Problem ihre Anlagen zu finanzieren.
Es ist inzwischen soweit, dass selbst fertige Anlagen kaum mehr den Erlös bringen um den Betrieb aufrecht zu erhalten. So gaben einige Sprecher auf der Tagung in Essen an, dass im Fall einer größeren Revision, etwa den Austausch einer Turbine, das Kraftwerke eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt werden müsste.
Dies hätte natürlich erhebliche Folgen für das Stromnetz, denn die Pumpspeicher dienen eben auch zur Stabilisierung des Netzes und sollen zukünftig ja Solarstrom und Windstrom puffern um zu anderen Zeiten des Bedarfs die entsprechende Energie zur Verfügung zu stellen.
 |
| Einige steile Thesen zur Wirkung von Pumpspeichern, vorgestellt von Peter Stratmann (Folien) |
An einen Neubau ist daher in Deutschland praktisch überhaupt nicht zu denken, was auch dazu führte, dass das bekannte Projekt Atdorf im Südschwarzwald, gestoppt wurde, obwohl bereits 60 Millionen Euro für die Planung ausgegeben wurden.
 |
| Ausbau der Pumpspeicherwerke ist fast zum Erliegen gekommen, dargestellt als gelbe Kreise, Reinhard Fritzer, ILF (Folien) |
Pumpspeicher in Österreich
Anders die Situation in Österreich, dort stehen wesentlich mehr Pumpspeicherkraftwerke, insbesondere was die Speicherkapazität betrifft. Diese kommt von den großen Gefällen in den Alpen um den erheblich größeren Staumauern und damit Speicher.Auf der Internationalen Pumpspeicher Tagung in Salzburg wurden die berühmte Anlage der Illwerke von Professor Helmut Jaberg vorgestellt. Ein Pumpspeicher mit über 800 m Fallhöhe und über einen Gigawatt Leistung.
 |
| Das Verhältnis Speicher zu Turbine ist in Österreich und in der Schweiz größer, womit länger gespeichert werden kann. |
Dies wird in den Medien oft irreführend dargestellt, als ob wir Strom ans Ausland verschenken und teuer wieder importieren. Nein, da liegt eine Dienstleistung dazwischen, dass die Energie gespeichert wird und genau dann geliefert wird, wenn wir bedarf haben!
Einnahmequellen für Speicher
Die sehr flache Preiskurve für Strom kann Speicher aktuell nicht finanzieren, aber es gibt auch andere Einnahmequellen für Speicher, etwa der Regelenergiemarkt. Dabei wird kurzfristig Energie bereitgestellt oder aufgenommen, um das Netz zu stabilisieren.
 |
| Regelenergie ist eine weitere Einnahmequelle für Pumpspeicher. |
Im Vortrag der Beratungsfirma BET aus Aachen wurden weitere Einnahmequellen vorgestellt.
 |
| Verschiedene Einnahmequellen für Speicher |
 |
| Die Lastgradienten wachsen in den letzten Jahren, daher ist schnelle Regelleistung erforderlich. |
Eine Alternative zu Speichern ist der Netzausbau, aber der geht leider sehr schleppend voran, sodass langfristig viel Energie, die aus Wind und Sonne kommen, nicht den Verbraucher erreicht.
 |
| Netzausbau, erst 3% sind 2016 geschafft, Folie Team Consult. |
Fazit
Pumpspeicher allein in einem Stromsystem zu betrachten ist nicht zielführend. Zukünftig müssen alle Komponenten eines modernen Stromnetzes zusammenarbeiten. Wind, Off- und Onshore, PV, Leitungen, Speicher in Deutschland aber auch jenseits der Grenze und das am besten mit fairen Regeln für alle Beteiligte.Mehr Konferenzberichte:
http://energiespeicher.blogspot.de/2013/11/konferenzberichte.html