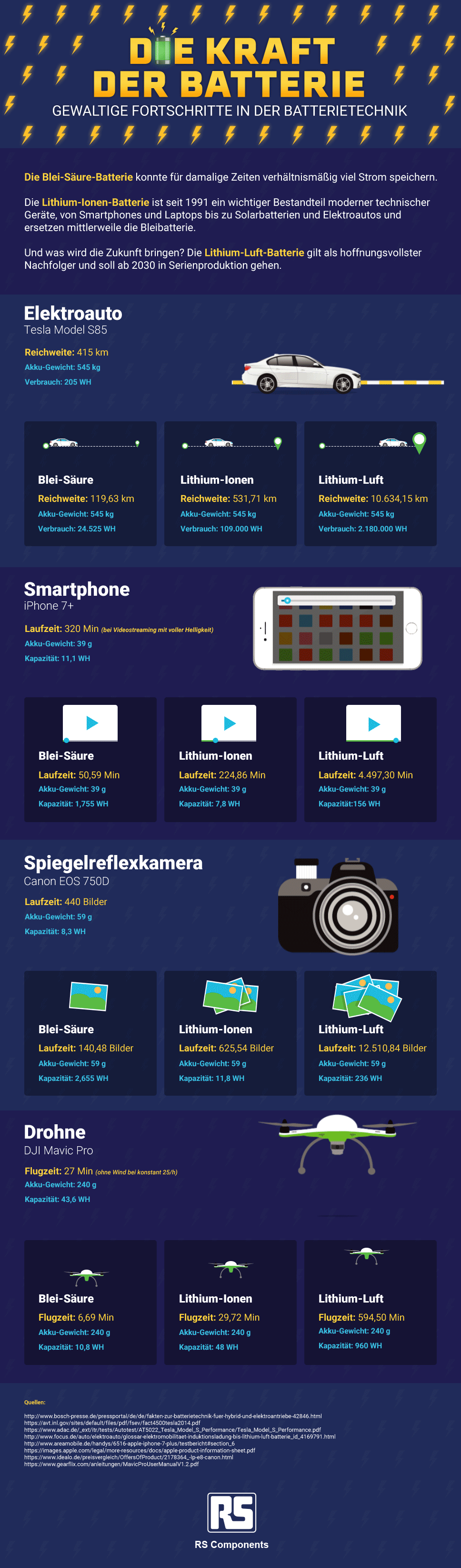Prof. Dr. Andreas Walter Bett: Pionier der Solarforschung
Prof. Dr. Andreas Walter Bett, geboren am 25. April 1962 in Furtwangen, ist ein renommierter deutscher Physiker und Solarforscher. Als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg und Professor für Solare Energie – Materialien und Technologien an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den 17. Europäischen Becquerel-Preis für herausragende Leistungen in der Photovoltaik, den EARTO-Innovationspreis für höchsteffiziente Konzentratorsolarsysteme und 2023 den Forschungspreis der Werner Siemens-Stiftung für das Projekt zur höchsteffizienten Erzeugung von Strom und Wasserstoff aus Solarenergie. Im Gespräch mit Prof. Dr. Eduard Heindl teilt er Einblicke in seine Karriere und die Entwicklungen am ISE, das 1981 gegründet wurde und heute rund 1400 Mitarbeiter beschäftigt. Bett, der aus dem Schwarzwald stammt, studierte Physik und Mathematik in Freiburg und fand über eine Diplomarbeit zu Halbleitermaterialien den Weg zur Solarenergie. "Ich habe mich dann entschieden zu promovieren und bin am Institut hängen geblieben", reflektiert er über seinen Einstieg, der von der Vision des Institutsgründers Prof. Goetzberger geprägt war, eine Energiewende voranzutreiben – inspiriert von der Ölkrise und Grenzen des Wachstums, nicht als Hype, sondern als Notwendigkeit.
Den vollständigen Vortrag finden Sie auf YouTube.
Geschichte und Mission des Fraunhofer ISE
Das ISE hat eine bewegte Geschichte: Von den Anfängen mit 60-70 Mitarbeitern in den 1980er Jahren bis zu kritischen Phasen in den 1990er Jahren mit Finanzierungsproblemen wuchs es zu einem Weltrekordhalter in der Photovoltaik. Bett betont die angewandte Forschung in Kooperation mit der Industrie, ergänzt durch wissenschaftliche Exzellenz und universitäre Anbindungen. Mit einem Budget von 150 Millionen Euro jährlich finanziert sich das Institut zu 10% aus Grundmitteln, der Rest aus Projekten und Industrieaufträgen (aktuell 25% direkt von der Industrie). Die Mission: Erneuerbare Energien weltweit vorantreiben, mit Fokus auf Systeme, nicht nur Zellen. Bett beschreibt Phasen von Aufschwung und Rückschlag, wie nach dem EEG in den 2000er Jahren, und hebt die intrinsische Motivation der Mitarbeiter hervor: "Die Leute kommen hierher, weil sie an einem Projekt mitarbeiten wollen, wo sie wirklich eine hohe intrinsische Motivation haben."
Solarzellentechnologien: Von Silizium zu Mehrfachzellen
Silizium dominiert den Markt wegen seiner Verfügbarkeit und Effizienz – das ISE spielte eine Schlüsselrolle bei der Steigerung des Wirkungsgrads auf fast das theoretische Limit von 29% (praktisch über 27%). "Wirkungsgrade sind ein extremer Hebel, weil die Gesamtkosten damit massiv sinken", erklärt Bett. Er kontrastiert dies mit III-V-Materialien wie Galliumarsenid, die für Weltraumanwendungen (z.B. Satelliten) höhere Effizienzen bieten und am ISE patentiert wurden. Der Weltrekord des ISE: 47,2% unter konzentriertem Licht mit einer Vierfach-Solarzelle. Konzentrierte PV reduziert Material um Faktor 1000 durch Optiken wie Brenngläser, eignet sich für sonnenreiche Gebiete, erfordert aber Nachführung und ist wolkenempfindlich. Bett diskutiert Tandemstrukturen mit Perowskiten auf Silizium für höhere Effizienzen und erwähnt Alternativen wie Kupfer statt Silber für Kontakte, um Kosten zu senken: "Silizium ist das zweithäufigste Element, da haben wir keine Limitierung – Silber kann man durch Kupfer ersetzen." Dünnschichttechnologien wie amorphes Silizium sind gescheitert, während CIGS oder CdTe Nischen besetzen.
Speicher und Sektorenkopplung: Batterien und Wasserstoff
Für die Integration fluktuierender Energien sind Speicher essenziell. Bett hebt Batterien für Kurzzeitspeicherung hervor, deren Kosten dank China gesunken sind; das ISE forscht an Lithium-Ionen, Natrium- und Zink-Ionen-Batterien. Für Langzeitspeicher und Dunkelflauten favorisiert er Wasserstoff: "Wir brauchen Wasserstoff als Ausgangsstoff für synthetische Kraftstoffe und Polymere – die molekulare Wende." Er sieht Synergien in der Industrie, wo Wasserstoff bereits gehandhabt wird, und diskutiert Träger wie Methanol oder Dimethylether. In Deutschland prognostiziert er einen Strombedarf von ca. 1000 Terawattstunden bis 2045 durch Elektrifizierung (Mobilität, Wärme), deckbar durch PV, Wind und Importe. "Die Primärenergie sinkt, weil Methoden effizienter sind", betont er. Agri-PV und Dachnutzung lösen Flächenprobleme, ohne Landwirtschaft zu beeinträchtigen.
Globale Perspektiven und Zukunft der Energiewende
Weltweit sieht Bett PV als dominant: Bis 2060 könnten 70 Terawatt installiert sein, mit jährlich 3-4 Terawatt Neuinstallationen, um CO2-neutral zu werden. China führt, doch USA und Indien bauen Produktion auf; Europa sollte Resilienz sichern, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Importe aus sonnenreichen Ländern wie Namibia machen Sinn: "Solarenergie wird hier immer teurer sein als in Regionen mit 2 Cent pro kWh." Bett plädiert für Industriepolitik und Vorbildfunktion Deutschlands: "Wenn wir zeigen, dass es mit Erneuerbaren kostengünstig geht, folgen andere." Er warnt vor Monopolen und fordert Diversifikation.
Sie finden alle Videos unter https://energiespeicher.blogspot.com/p/energiegesprache-mit-eduard-heindl.html
Solarenergie, Fraunhofer ISE, Wirkungsgrad, Wasserstoff, Energiewende





_EN.svg/2000px-Periodic_table_(German)_EN.svg.png)